|
|
|
|
|
|
|
Tipp für
Stories | Hier werben | Story
übernehmen Frühere News
|
|
ECHO |
|
"Netz an Überwachungskameras nimmt totalitäre Züge an"
Wer das Buch "George Orwell - 1984" gelesen hat, wird feststellen, dass der Überwachungsstaat immer wahrscheinlicher wird. Bald werden wir ja auch in unseren eigenen vier Wänden kontrolliert, welche Internetseiten wir uns anschauen. Wie Pilze aus dem Boden wurden oder werden weiter auf dem gesamten Kantonsgebiet Überwachungskameras aufgestellt. Dies vorab wegen der Verkehrssicherheit auf dem Strassengebiet. Die neuesten Kameras wurden bei der Autobahnbrücke, Ausfahrt Pratteln, montiert. Sind denn die Verkehrsteilnehmer wirklich so schlimme Sünder, dass es immer mehr Kameras braucht? Das Netz an Überwachungsgeräten im Kantonsgebiet nimmt langsam aber sicher totalitäre Züge an. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Einnahmequelle für den Staat geradezu lohnend ist. Darum werden ja gerade an hoch frequentierten Kreuzungen Kameras aufgebaut, obwohl es an diesen Standorten praktisch keine Fussgänger hat und die Zahl der Verkehrsunfälle äusserst gering ist. Wo hingegen innerorts Tempo 30 gilt, kann man praktisch keine Kameras feststellen. Doch dort begegnen sich Fussgänger und Temposünder. Dort wäre es sinnvoll, der Verkehrssicherheit mehr Achtung zu schenken. Es gilt offenbar jene Quellen zu erschliessen, wo auch am meisten abgeschöpft werden kann. Samuel Wehrli |
EuroAirport in der Krise: Verletzung des Bundesbeschlusses nicht ausgeschlossen
VON PETER KNECHTLI
BASEL. - Der EuroAirport in der Krise: Sinkende Passagierzahlen, heimlicher Abzug der Swiss vom Basler Flufhafen und gleichzeitig geringere Gebühreneinnahmen, steigende Schulden und Kapitalkosten. Was OnlineReports in den letzten Wochen dokumentiert hat, findet jetzt seinen Niederschlag in einem brisanten Vorstoss der SP-National- und Grossrätin Anita Fetz. Sie wirft unter anderem die Frage auf, ob nicht klare Leitplanken der Zwei-Milliarden-Finanzierung beim Aufbau der Swiss durch den Bund verletzt werden.
Als das Eidgenössische Parlament im November 2001 der Swiss mit blanken zwei Milliarden Franken Steuergeldern unter die Arme griff, war die Zustimmung klar an die Verfplichtung der Swiss geknüpft, dass die neue nationale Fluggesellschaft "auch die Interessen aller Landesflughäfen angemessen berücksichtigt". An diese staatspolitisch bedeutende Rahmenbedingung scheint sich die Swiss nicht mehr allzu sehr zu erinnern. Zwar bleibt Basel - neben Zürich - einer der beiden Schweizer Hauptsitze, aber auf den EuroAirport-Pisten ist Abbau angesagt: Es droht die Aviatik-Einöde vor der Toren der zweitwichtigsten Schweizer Wirtschaftsregion. In einem ersten Schritt stillgelegt oder rückgebaut wurden die Linien nach Alicante und Göteborg sowie Bern und Lugano. Branchenkenner glauben, dass der Abbau an Swiss-Linien und -Frequenzen zugunsten Zürichs noch weiter geht, auch wenn Baselbieter FDP-Nationalrat Paul Kurrus, Swiss-Kadermitglied, dies nicht wahrhaben will. "Basler Steuergelder schützen Zürcher Grosskapital", spitzt Fetz die drohende Entwicklung zu.
Weil das Problem EuroAirport offenbar an den weitgehend aus Politikern zusammengesetzten Verwaltungsrat delegiert ist, schien sich in der Basler Politik bisher kaum jemand um die Krise der Luftverkehrs-Drehscheibe wirklich zu kümmern, obschon es sich beim EuroAirport um ein öffentlich-rechtliches Unternehmen mit Staatsgarantie handelt. Erstaunlich, dass auch parlamentarischen Exponenten die wichtigsten Eckdaten des Euro-Airports nicht geläufig waren, die es als Promotoren desselben eigentlich wissen müssten. In ihrer Interpellation "betreffend Zukunft des EuroAirports und Swiss-Abbaupläne" stellt Anita Fetz nun fest, dass bei einem Abzug der Swiss mehrere Hundert Arbeitsplätze am Boden und in der Luft gefährdet seien. Genau dies habe die Milliarden-Spritze des Bundes verhindern wollen. Es sei nun höchste Zeit, dass der Regierungsrat zuhanden der Basler Öffentlichkeit offensiv Informationen beschafft und sich dezidiert für den EuroAirport einsetzt."
Die Parlamentarierin stellt mehrere Fragen, auf deren ungeschminkte Antwort man jetzt schon gespannt sein kann:
• Was weiss die Regierung über einen allfälligen Strategiewechsel der Swiss? Ist sie von der Swiss –Spitze über allfällige Abbaupläne informiert worden? Welche Auswirkungen werden diese auf den EuroAirport in Basel haben? Wieviel Arbeitsplätze wären in Basel in welchen Bereichen gefährdet?
• Ob die Regierung bereit sei, "beim Bundesamt für Zivilluftfahrt, beim Bundesrat und beim Verwaltungsrat der Swiss massiv vorstellig zu werden", damit die angemessene Berücksichtigung aller Landesflughäfen eingehalten wird und ein allfälliger Swiss-Abbau nicht einseitig zulasten Basels durchgeführt wird.
• Ob sich die Regierung bewusst sei, "dass durch die einseitige Zusammensetzung des Swiss-Verwaltungsrates (im Volksmund auch 'Rainer-G-Rat' genannt), die Gefahr besteht, den Swiss Flugverkehr von Basel nach Zürich umzuleiten, damit das private Kapital, das im Zürcher Unique steckt, geschützt wird, während im Gegenzug die wegfallenden Landetaxen in Basel dazu führen, dass die Verluste durch öffentliche Zuschüsse gedeckt werden müssen".
• Ob sich der Regierungsrat vorstellen könne, "das Swiss-Aktienpaket abzustossen, um symbolisch auszudrücken, dass in Basel eine Konzentration in Zürich auf Kosten des EuroAirports als extrem 'un-freundeidgenössischer Akt' zur Kenntnis genommen wird". Fetz dazu: "Wir sind nicht bereit, auch noch die Fehlplanungen des Züricher Flughafens über Steuermittel indirekt mit zu subventionieren."
Weitere Fragen betreffen die soziale Abfederung eines möglichen Arbeitsplatzabbaus und die Ausarbeitung einer Swiss-unabhängigen Strategie im Verwaltungsrat. Schliesslich will Anita Fetz wissen, ob die Regierung ausschliessen könne, dass künftige EuroAirport-Defizite und Investitionen mit öffentlichen Mittelns gedeckt werden. (12. Februar 2003)
• "Luzernerring": Die gefährlichste BVB-Haltestelle Basels wird saniert
BASEL. - Am 11. Dezember letzten Jahres hat OnlineReports über Basles gefährlichste Tramhaltestelle "Luzernerring" berichtet. Die Traminsel ist zu kurz geworden, seit die BVB auf der Linie 3 seit über fünf Jahren längere Tramkompositionen einsetzen. Weil viele Automobilisten am haltenden Tram rechts vorbeifahren, kommt es dort für aussteigende Passagiere regelmässig zu gefährlichen Situationen. Nach jahrelanger Plan- und Warterei soll die Traminsel jetzt endlich verlängert und verbreitert werden. Kostenpunkt inklusive einiger Umgebungsarbeiten: 250'000 Franken. Falls der Grosse Rat dem dringlichen Begehren zustimmt, sollen die Bauarbeiten diesen Sommer durchgeführt werden. (9. Februar 2003)
"Man hat nicht den Eindruck, es drohe Krieg"
VON RUEDI SUTER
Von der irakischen Bevölkerung begeistert, aber entsetzt von den Lebensumständen, die das 12-jährige Embargo verursacht hat, ist der deutsche Friedensaktivist Detlev Quintern (42) aus Bagdad heimgekehrt. Seine Forderung: "Kein Krieg gegen den Irak!" OnlineReports befragte ihn nach seinen Eindrücken.
Zum Mekka verschiedenster Friedensgruppen geworden ist in den letzten Wochen Iraks Hauptstadt Bagdad. Man will vor Ort ein Zeichen des Friedens setzen und sich selbst ein Bild über die Lage der seit 12 Jahren unter einem Embargo leidenden Zivilbevölkerung machen. Eben heimgekehrt ist jetzt der deutsche Historiker und Museologe Detlev Quintern aus Bremen. Eine Woche lang bereiste er mit 32 weiterenTeilnehmern der "Weyher Initiative für den Frieden" Bagdad, Basra und Kerbala, um dieses Wochenende über Basel heimzukehren.
"Am meisten beeindruckt hat mich, dass die Bevölkerung trotz Blockade und ständigen Kriegsdrohungen sehr friedlich und gelassen wirkte. Man hat nicht den Eindruck, es drohe ein Krieg", erklärte Quintern gegenüber OnlineReports. Die Delegation habe sich frei bewegen und die sie begleitenden Medienleute vom Nachrichtenmagazin"Der Spiegel" oder der ARD ungehindert arbeiten können. "Wir konnten alles sehen, was wir wollten, und wir spürten keinerlei Einschränkungen." Die
 Menschen seien "mit grosser Herzlichkeit" auf die Besucher zugekommen und trotz ihrer materiellen Not rührend gastfreundlich gewesen.
Menschen seien "mit grosser Herzlichkeit" auf die Besucher zugekommen und trotz ihrer materiellen Not rührend gastfreundlich gewesen.Quintern beurteilt die irakische Bevölkerung in erster Linie über ihre 8000 Jahre alte Geschichte und nicht über das mörderische Regime von Saddam Hussein: "Die Warmherzigkeit der Menschen stammt aus dem tief wurzelnden Humanismus der arabischen Kultur, der nicht zerstört werden kann."
Die von der in Deutschland und im Irak tätigen Nichtregierungsorganisation "Solidarität für Frieden, Freundschaft und Solidarität" eingefädelte Kurzvisite führte auch in Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen. Die "erschütterndsten Erlebnisse" trägt Quintern aber aus Krankenhäusern in Bagdad und Basra heim: "In den Kinderstationen - das Bild links entstand 1991 im kurdischen Teil Iraks - trafen wir auf Kinder, die mit Leukämie und anderen Krebserkrankungen eingeliefert waren. Ihnen bleibt kaum Zeit zu leben, weil die Blockade sowohl die Einfuhr notwendiger Diagnoseinstrumente als auch die von Medikamenten verhindert." Die rapide angestiegene Krebsrate unter Kindern wird auf den tonnenweisen Einsatz von uranhaltiger Munition der USA im zweiten Golfkrieg 1991 zurückgeführt. Da auch Brutkästen unter die Blockadebestimmungen fallen, müssten viele Neugeborene ihr Leben lassen.
Kein besseres Los hätten zahlreiche Menschen mit Darm-, Nieren-, Leber-, Infektions- und anderen Erkrankungen. Quintern erinnert daran, dass einige der schweren Erkrankungen vor 1991 im Irak unbekannt waren. Auch stürben Monat für Monat an die 6000 Kinder, weil die Blockade vielfach selbst die medizinische Versorgung verunmögliche. Neben den Medikamenten fehlten Ersatzteile beispielsweise für Wasserpumpen oder auch Chemikalien, die zur Herstellung von Chlor für die Trinkwasserwiederaufbereitung benötigt werden. Für Detlev Quintern ist deshalb klar: "Die Blockade gegen das irakische Volk muss aufgehoben und der Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten eingehalten werden. Das heisst für uns: Kein Krieg gegen den Irak!"
Da das trickreiche Regime Saddam Husseins die westlichen Friedensorganisationen zurzeit besonders hätschelt, wurde die Gruppe auch von Iraks Vizepräsident Tarek Azis empfangen. Dieser beeindruckte Quintern durch seine "sehr ruhige, nachdenkliche und gescheite Art". Die irakische Bevölkerung werde sich wehren und den Angreifern als letzte Waffe auch Sand in die Augen werfen. Dann erklärte Azis der Delegation den Hintergrund des drohenden Krieges: Mit dem Zugriff auf die zweitgrössten Erdölvorkommen der Welt im Irak wolle die USA die Restwelt in ihre Abhängigkeit bringen - und halten. Denn dies sei ein Krieg gegen alle Völker, die anders seien als die USA, habe Azis seine Besucher aus Europa gewarnt. (8. Februar 2003)
• Hotel "Balade": Hilfe-Aktion mit Sponsoring-Nacht erfolgreich
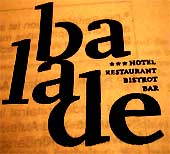 BASEL. - Das Kleinbasler Hotel-Restaurant "Balade" hat seine akute Liquiditätskrise - Anfang Jahr fehlten 100'000 Franken - überwunden: Wie Franz Leugger, für den Hotelbetrieb zuständiger Geschäftsführer, gegenüber OnlineReports bestätigte, sei "das Problem im Moment gelöst". Nach dem Aufruf an "Freunde und Bekannte" Anfang Januar, in dem als Termin zur Garantie der Finanzlücke spätestens Mitte Februar genannt wurde, sei der überlebensnotwendige Betrag bereits knapp beisammen. Laut Leugger sei das Hotel "Balade" jedoch angewiesen auf die Einnahmen, die von einer bevorstehenden "Sponsoring-Nacht" erwartet werden. Wie lange die Freundes-Hilfe das Überleben sichert, weiss Leugger "noch nicht". Aber soviel ist klar: "Wenn wir diese Hürde geschafft haben, dann bin ich zuversichtlich." (7. Februar 2003)
BASEL. - Das Kleinbasler Hotel-Restaurant "Balade" hat seine akute Liquiditätskrise - Anfang Jahr fehlten 100'000 Franken - überwunden: Wie Franz Leugger, für den Hotelbetrieb zuständiger Geschäftsführer, gegenüber OnlineReports bestätigte, sei "das Problem im Moment gelöst". Nach dem Aufruf an "Freunde und Bekannte" Anfang Januar, in dem als Termin zur Garantie der Finanzlücke spätestens Mitte Februar genannt wurde, sei der überlebensnotwendige Betrag bereits knapp beisammen. Laut Leugger sei das Hotel "Balade" jedoch angewiesen auf die Einnahmen, die von einer bevorstehenden "Sponsoring-Nacht" erwartet werden. Wie lange die Freundes-Hilfe das Überleben sichert, weiss Leugger "noch nicht". Aber soviel ist klar: "Wenn wir diese Hürde geschafft haben, dann bin ich zuversichtlich." (7. Februar 2003)Konkurs

"Die vier sind gewählt": Kandidaturen der bürgerlichen Wahlallianz
Wahlen im Baselbiet: Gemeinsames Lächeln
für den Sieg der bürgerlichen Allianz
VON PETER KNECHTLI
LIESTAL. - Erstmals präsentierten sich an einer gemeinsamen Medienkonferenz in Liestal die vier Kandidatinnen und Kandidaten der "Bürgerlichen Zusammenarbeit" (Büza) für die Baselbieter Regierungsratswahlen von Ende März (v.l.n.r.): Die neue Freisinnige Sabine Pegoraro und die Bisherigen Erich Straumann (Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektor, SVP), Elsbeth Schneider (Bau- und Umweltschutzdirektorin, CVP) und Finanzdirektor Adrian Ballmer (FDP).
"Vier mal Stabilität und Fortschritt" heisst der gemeinsame Slogan-Nenner, der durchaus Anlass zu tiefen philosophischen Debatten geben mag. Die vier Bewerberinnen und Bewerber, die sich im politischen Alltag wohl gelegentlich auch die Zähne zeigen, präsentierten sich allesamt als loyale und erst noch geschlechterparitätische Teamplayer, die Gewähr gegen die "momentane Katerstimmung im Kanton" (so Pegoraro) und das "verschlechterte Klima zwischen Parlament und Regierung" (Ballmer) seien.
Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider gestand ihre Überraschung bei der Durchsicht dessen, was in ihrer bisherigen Amtstätigkeit "alles positiv lief". Es sei so viel, dass dies die Öffentlichkeit gar nicht vollständig zur Kenntnis genommen habe. Als Beispiele nannte sie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Bemühungen, nun auch die rote Linie im Ergolztal einzuführen, das Entwicklungsprojekt Salina Raurica, den langen SBB-Wisenbergtunnel ("die Wunschvariante des Ergolztals") oder den kostenträchtigen Neu- und Umbau des Kantonsspitals Liestal ("trotz allem ein Highlight").
Gesundheitsminister Erich Straumann zeigte sich froh, dass er nicht mehr, wie beim letzten Wahlkampf 150 Auftritte benötige, um Bekanntheit zu erlangen. Zudem habe er selbst "sehr vieles zur Büza beigetragen". Er nahm die zentralen Bemühungen zur Bekämpfung der Adtranz-Krise für sich mit in Anspruch, nannte das fünf Paragraphen starke Tourismusgesetz als Referenz und seine Bemühungen, auch "Life sciences" (perfekt ausgesprochen!) im Baselbiet anzusiedeln. Dass er von der Regierung häufiger als andere mit Geschäften heimgeschickte wurde, parierte Straumann tapfer mit dem Hinweis, die Prüfung seiner Geschäfte durch seine Regierungskolleg(inn)en sei "richtig". Unerschrocken prognostizierte er einen Büza-Wahlsieg: "Es ist klar, die vier sind gewählt."
Er komme sich in der Regierung manchmal "wie ein Hirtenhund" vor - während dieser Passage klopfte ihm Elsbeth Schneider liebevoll auf Schulter -, sagte Finanzminister Adrian Ballmer. In seinen zweieinhalb Jahren habe er sich gut in die Regierungstätigkeit eingelebt. Doch müssten das Atmosphärische und die Kommunikation verbessert werden. Direktionsintern schlage er bei Ausgabenwachstum Alarm, wobei er ein striktes Leistungs- und Wirkungscontrolling pflege. Es sei "Quatsch", ihn als Partnerschaftsgegner zu bezeichnen: "Wir brauchen ein starkes Zentrum Basel, aber über die Höhe der Baselbieter Beitrags-Millionen soll man streiten dürfen." Ein waches Auge hält Ballmer auch auf den in eine "gewisse Schieflage" geratenen EuroAirport und sein Ertragsproblem.
Die Novizin Sabine Pegoraro hatte das Privileg, keine Regierungsbilanz ablegen zu müssen. Als promovierte Juristin sei naheliegend, dass ihr die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion am ehesten am Herzen liege. Sie wäre aber auch bereit, die frei werdende Erziehungsdirektion zu übernehmen. Finanzen, Sicherheit ("mehr Präsenz der uniformierten Polizei auf öffentlichen Plätzen"), Ausbildung und Lehrstellensuche sowie eine verbesserte Familienpolitik mit mehr externen Betreuungsplätzen sind Pegoraros Polit-Prioritäten. (5. Februar 2003)
• OnlineReports unter den "200 besten Websites der Schweiz"
 Die Internet-Fachzeitschrift "smile" hat in ihrer jüngsten Ausgabe eine Liste der "200 besten Websites der Schweiz" veröffentlicht. Es freut uns, dass OnlineReports in diese Kategorie vorgerückt ist. Besondere Freunde macht uns, dass wir mit dem 6. Rang in der Kategorie "E-Zines" (elektronische News-Magazine) noch vor der renommierten Finanzplattform "Moneycab" platziert sind. Wir betrachten dieses Ranking als eine Bestätigung dafür, dass auch kleine Anbieter mit dem richtigen Konzept die Chance haben, ganz vorne dabei zu sein. Unser zuverlässiges Informantennetz, unsere soliden Eigenleistungen und unsere Aktualität haben OnlineReports beim Publikum und in Fachkreisen zu einer attraktiven Plattform gemacht. Wir bedanken uns bei unserem nachhaltig wachsenden Publikum und bei unseren Werbekunden für die Treue und aktive Begleitung unseres Mediums. (4. Februar 2003)
Die Internet-Fachzeitschrift "smile" hat in ihrer jüngsten Ausgabe eine Liste der "200 besten Websites der Schweiz" veröffentlicht. Es freut uns, dass OnlineReports in diese Kategorie vorgerückt ist. Besondere Freunde macht uns, dass wir mit dem 6. Rang in der Kategorie "E-Zines" (elektronische News-Magazine) noch vor der renommierten Finanzplattform "Moneycab" platziert sind. Wir betrachten dieses Ranking als eine Bestätigung dafür, dass auch kleine Anbieter mit dem richtigen Konzept die Chance haben, ganz vorne dabei zu sein. Unser zuverlässiges Informantennetz, unsere soliden Eigenleistungen und unsere Aktualität haben OnlineReports beim Publikum und in Fachkreisen zu einer attraktiven Plattform gemacht. Wir bedanken uns bei unserem nachhaltig wachsenden Publikum und bei unseren Werbekunden für die Treue und aktive Begleitung unseres Mediums. (4. Februar 2003)• Kindersex-Affäre in Eptingen: Aufklärung gefordert - Gemeinderat bockt
EPTINGEN. - Der OnlineReports-Bericht über die sexuellen Übergriffe in der Oberbaselbieter Gemeinde Eptingen, zuerst im "Beobachter", dann ausführlicher auf OnlinReports dokumentiert, warf landesweit Wellen. Nicht nur erhielt die betroffene Familie Bitterlin aus allen Landesteilen Briefe und gar Spielzeuge, auch wurden Bewohnerinnen und Bewohner in Eptingen selbst aktiv: "Empört und besorgt" über den behördlichen Umgang mit der Affäre fordern vierzig Bürgerinnen und Bürger eine ausserordentliche Gemeindeversammlung, an der die Gemeindebehörden die "längst überfälligen Auskünfte" darüber erteilen, "wie es zu diesem Debakel kommen konnte". Unter den Verfassern des Offenen Brief befindet sich auch der Sänger und Schauspieler Florian Schneider ("Phantom"). Doch der Gemeinderat blockt ab und will keine öffentliche Orientierung durchführen. Eine Information über sexuelle Übergriffe könne laut Gemeindegesetz kein Thema einer Gemeindeversammlung sein. (4. Februar 2003)
|
ECHO |
|
"Was muss die Familie Bitterlin noch aushalten?"
Wir sind empört über den Gemeindepräsidenten und den Gemeinderat von Eptingen. Was muss denn noch geschehen, dass die Bevölkerung orientiert wird! Dies ist eine riesige Schweinerei. Was die Familie Bitterlin alles mitmachen musste und noch immer muss, geht über unsere Vorstellungskraft. Empört sind wir auch über die Klagen des Gemeindepräsidenten, er habe anonyme Briefe, Faxe etc. erhalten. Zumindest in unserem Fall stimmt dies nicht. Auch wir haben ihm sowie dem Schulinspektor einen namentlich unterzeichneten Brief geschrieben. Wir mussten unseren Frust zudem auch bei Ihnen ablassen, exgüsi, aber eigentlich sind wir Ihnen dankbar, dass Sie den Mut haben, über diesen Fall zu berichten. Esther Hunziker und Familie |
• Mord an brasilianischem Indianerführer Marcos Vernon
BRASILIA. - Marcos Veron (ca. 70, Bild) ist Mitte Januar in Brasilien von Revolvermännern erschossen worden. Der bekannte Indianerführer der Guarani-Kaiowá bereiste vor gut zwei Jahren Europa, um Hilfe für sein Volk zu erbitten. Die Guarani-Kaiowá kämpfen seit 50 Jahren um die Rückgabe ihres Landes, das von reichen Rin
 derzüchtern besetzt wird: "Die Rancher schiessen auf uns, brennen unsere Häuser ab und töten unsere Kinder. Sie versuchen, uns von unserem letzten Land zu vertreiben", erklärte Veron damals. Laut der Menschenrechtsorganisation Survival International (SI), die ihn einlud und nun auch seinen Tod meldete, leiden die Guarani-Kaiowá heute "unter einer der weltweit höchten Selbstmordraten". Veron sagte: "Dieses Land ist meine Seele. Wenn man mich hier wegnimmt, nimmt man mir mein Leben." Dies sei jetzt auf tragische Weise eingetreten, erklärte Stephen Corry von SI mit einem Verweis auf die desolate Lage von Brasiliens Urvölker, die von der neuen Regierung drigend geschützt werden müssten. Denn Marcos Veron ist der dritte Indianerführer, der schon seit Jahresbeginn ermordet wurde. (3. Februar 2003) Foto © J.Ripper/Survival
derzüchtern besetzt wird: "Die Rancher schiessen auf uns, brennen unsere Häuser ab und töten unsere Kinder. Sie versuchen, uns von unserem letzten Land zu vertreiben", erklärte Veron damals. Laut der Menschenrechtsorganisation Survival International (SI), die ihn einlud und nun auch seinen Tod meldete, leiden die Guarani-Kaiowá heute "unter einer der weltweit höchten Selbstmordraten". Veron sagte: "Dieses Land ist meine Seele. Wenn man mich hier wegnimmt, nimmt man mir mein Leben." Dies sei jetzt auf tragische Weise eingetreten, erklärte Stephen Corry von SI mit einem Verweis auf die desolate Lage von Brasiliens Urvölker, die von der neuen Regierung drigend geschützt werden müssten. Denn Marcos Veron ist der dritte Indianerführer, der schon seit Jahresbeginn ermordet wurde. (3. Februar 2003) Foto © J.Ripper/Survival• Neue Asylpolitik: Basel soll Zürcher Idee aufnehmen
BASEL/ZÜRICH. - Der Kanton Basel-Stadt soll die Offensive für eine neue Asylpolitik aufnehmen, die am Samstag der Zürcher Stadtrat lancierte (vgl Kasten). Dies fordert der Basler SP-Grossrat Roland Stark in einer Interpellation. Da die bisherige Abschreckungspolitik durch Arbeitsverbot versagt habe,
Zehn Regeln für eine neue Schweizer Asylpolitik: 1. Asyl Suchende zur Arbeit berechtigen und verpflichten 2. Nützliche Arbeitsangebote breit stellen 3. Den Aufenthalt der Asyl Suchenden durch deren eigene Arbeit finanzieren 4. Kinder und Jugendliche ausbilden 5. Unterkünfte von Asyl Suchenden selbst organaisieren lassen 6. Unterstützung durch Landsleute einfordern 7. Asylentscheide beschleunigen 8. Leistungen der Gemeinden durch Bund und Kantone finanzieren 9. Kriminelle Asyl Suchende sofort ausschaffen 10. Dringliche nationale Asykonferenz einberufen |
Ihre Meinung?
|
ECHO |
|
"Alles nur Augenwischerei"
Das "Zürcher Modell" wird vor allem einen Effekt haben: Die Schweiz wird für Asylanten noch attraktiver als ohnehin. Zudem ist es für Basel denkbar ungeeignet. Die Basler Arbeitslosenquote liegt, -"dank" den Grenzgängern und dem freien EU-Personenverkehr - weit über dem Landesdurchschnitt. Da würden sich die Arbeitslosen und die Noch-Erwerbstätigen aber freuen, wenn zusätzlich noch die Asylanten in den ausgetrockneten Arbeitsmarkt gedrängt würden. Eine Kosteneinsparung würde sich nicht ergeben, lediglich eine Verlagerung, indem bisher Erwerbstätige in die Arbeitslosigkeit verbannt und somit der Allgemeinheit zur Last fallen würden. Eine Entlastung sowohl der Staatskassen wie auch des öffentlichen Raums wird nur erfolgen, wenn die Asylgesuche speditiv behandelt und die rund 95 Prozent Abgewiesenen ebenso speditiv rückgeführt, bzw. ausgeschafft werden. Alles andere ist Augenwischerei. Abdul R. Furrer
Erika Bachmann
Bruno Heuberger
André Rodoni |
Trennung von BaZ-Finanzchef Peter Wyss:
Zu starke Chef-Ambitionen
BASEL. - Kurzfristig haben die Basler Mediengruppe (BM) und ihr Finanzchef Peter Wyss (55, Bild rechts) getrennt. Laut offiziellem 3-Zeilen-Communiqué "wird" Wyss, seit Juli1994 im Unternehmen, die Mediengruppe "im ersten Quartal 2003 verlassen". Wie CEO Beat Meyer (Bild links) gegenüber OnlineReports bestätigte, hat Wyss seinen Sessel jedoch bereits geräumt. Die Trennung sei "in gegenseitigem Einvernehmen", jedoch kurzfristig erfolgt. Darauf hätten sich Geschäftsleitung und
 Wyss geeinigt. Wyss wolle sich "beruflich neu orientieren". Angaben dazu wollte Meyer nicht machen. Wyss werde zu gegebener Zeit darüber informieren.
Wyss geeinigt. Wyss wolle sich "beruflich neu orientieren". Angaben dazu wollte Meyer nicht machen. Wyss werde zu gegebener Zeit darüber informieren.Gegenüber OnlineReports verneinte BM-Verwaltungsratspräsident Matthias Hagemann, dass die wirtschaftliche Lage des Unternehmens oder ein Einzelfall zur Trennung von Wyss geführt habe. Weiter wolle er sich vereinbarungsgemäss nicht äussern. Wie OnlineReports aber andernorts in Erfahrung bringen konnte, war die Verstimmung zwischen Wyss und CEO Beat Meyer der Trennungsgrund. Wyss habe nach aussen gern "den Chef spielen" wollen - ja noch mehr: Er habe selbst auf den Posten des Konzernchefs spekuliert. Mit diesen Erwägung konnte Wyss nicht konfrontiert werden. Eine Anfrage von OnlineReports blieb unbeantwortet - eine Hinweis auf seine Qualitäten als Kommunikator.
Nicht als Erfolg kann Wyss, vom früheren Direktor Peter Sigrist geholt, die 15 Millionen Franken Verluste der Pensionskasse verbuchen, die Jürg Weiss, der frühere Finanzchef der Jean Frey AG, der Basler Mediengruppe eingebrockt hat. Wyss war - nicht strafrechtlich - mitverantwortlich dafür, dass Weiss mit dem Cash-Pooling der Vorsorgegelder beauftragt wurde, und er war auch Mitglied der Anlagekommission. Das Strafverfahren gegen Weiss ist immer noch hängig. Beteiligt war Wyss auch am Verkauf der Jean-Frey-Gruppe, der mit Ringier nicht zustande kam und zwischen den beiden Verlagshäusern zu bösem Blut führte, aber via Zwischenverkauf an die Swissfirst an eine multiple Investorengruppe um Hauptaktionär Tito Tettamanti doch noch zum Erfolg führte.
Wyss-Vertraute schildern den ex-Finanzchef, der in jungen Jahren Compagnon des heutigen Baselbieter Kantonalbank-Chefs Paul Nyffeler und später Finanzverwalter des Kantons Baselland war, als schillernde Persönlichkeit: Hier der schlaue Trickser, machtbewusste Ökonom und selbstbewusste Polterer "mit einer Sprache, die die Leute schockieren kann", dort der sensible und kulturell interessierte Bürger und Vizepräsident des Basler Theaters. Eine Mischung, die mit dem ebenfalls sensiblen und grundanständigen Schaffer Beat Meyer jedenfalls zunehmend Disharmonieen erzeugte: "Die geigten einfach nicht miteinander."
Der auseinander driftende Stil des Führungsduos machte sich erstmals in voller Kraft bemerkbar, als die beiden nach der gegen "20 Minuten" verlorenen Schlacht um die Präsenz des "Baslerstabs" in den Vorortszügen der BLT bei der zuständigen Baselbieter Baudirektorin Elsbeth Schneider vorsprachen. Die Mediengruppe-Topmanager kamen im Regierungsbüro mit einem verbalen Geschütz aufgefahren, dass der BLT-Verwaltungsratspräsidentin Hören und Staunen verging. Als besonders forsch soll dabei Wyss an die Regierungsrätin herangetreten sein und ihr unverfroren mit dem Einsatz der publizistischen Waffe durch die BaZ-Redaktion ("ein Schützenfest") gedroht haben. Gut zwei Jahre später scheint das Schützenfest im eigenen Hause stattgefunden zu haben.
Bis zum definitiven Entscheid über die Neubesetzung der Stelle wird der bisherige Wyss-Stellvertreter, Jürgen Hunscheidt (41), die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen der Basler Mediengruppe übernehmen. Er werde später diese Position auch offiziell übernehmen, sagte Meyer. (29. Januar 2003)
• Ciba-Explosion in Schweizerhalle: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein
BASEL. - Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat das Strafverfahren über das Explosionsunglück im Werk Schweizerhalle der Ciba-Spezialitätenchemie vom 26. Juli 2001 eingestellt. Dies mangels hinreichenden Nachweisen für ein strafbares Verhalten. Wie ein von den Untersuchungsbehörden angefordertes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aufzeigt, führte austretendes Tetrahydrofuran (THF) zur Explosion. An allen Stockwerken des betroffenen Gebäudes entstand erheblicher Sachschaden. 21 Feuerwehrleute zogen sich bei den Löscharbeiten Verletzungen zu. Weil der Lagerungszustand von Lithium in THF gemäss Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes als risikoarm bewertet werden durfte, könne "den Verantwortlichen nicht vorgeworfen werden, keine zusätzlichen Abklärungen oder weitere Sicherheitsmassnahmen getroffen zu haben". Im konkreten Fall hat sich somit ein ursprünglich als gering bewertetes Restrisiko verwirklicht. Eine Fremdeinwirkung von aussen, eine mangelhafte Wartung oder Manipulationsfehler von Betriebsmitarbeitenden konnten durch die Untersuchung ausgeschlossen werden. Keinem Beteiligten könne deshalb ein Verstoss gegen strafrechtliche Normen nachgewiesen werden kann. (29. Januar 2003)
• Steuerpolitik: Gysin macht mit zwei Initiativen weiter Druck
LIESTAL. - Die Volksrechte-Maschinerie des Baselbieter FDP-Nationalrats und Gewerbedirektors Hans Rudolf Gysin läuft weiter: Am Montag reichte das "Überparteiliche Komitee für die Wohnkosten-Gleichbehandlungs- und die Wohnkosten-Entlastungs-Initiative", dem Gysin vorsteht, zwei Gesetzesinitiativen ein. Die beiden Volksbegehren sind mit je über 10'000 Unterschriften innerhalb von nur dreiwöchiger Sammlungsfrist zustande gekommen. Die beiden Initiativen fordern, "dass einerseits zwischen Mietern und Wohneigentümern dauerhaft die steuerliche Gleichbehandlung sichergestellt und andererseits die für den Kanton Baselland seit langem sehr erfolgreichen Wohneigentumsförderung weitergeführt und ausgebaut werden kann", wie das Komitee mitteilt. Damit sorgt das Komitee aus Kreisen der Hauseigentümer und der Liga der Baselbieter Steuerzahler weiterhin für Handlungsdruck. Das Komitee bekämpfte letzten November nicht nur erfolgreich das revidierte Steuergesetz mit den nach seiner Meinung zu hohen Eigenmietwertansätzen, sondern reichte in der Zwischenzeit auch noch eine Verfassungsinitiative ein, welche die Grundlage der jetzigen Gesetzesinitiativen legt. Damit habe das Komitee seine nach der Ablehnung des Steuergesetzes abgegebenen Versprechen erfüllt, erklärte Gysin am Montag nach Einreichung der Unterschriften. Noch in diesem Jahr, so die Erwartungen der Initianten, sollen Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden. "Mit etwas gutem Willen könnten die Forderungen der Initiativen bereits per 1. Januar 2004 in Kraft gesetzt werden." (27. Januar 2003)
• Verkauf an Ixos: Obtree geht in deutsche Hände über
BASEL. - Die Basler Content-Management-Firma Obtree wird an den deutschen Software-Multi Ixos (über 180 Millionen Franken Umsatz) verkauft. Der Entscheid wurde heute Freitag an einer Medienkonferenz in Basel offiziell bekannt gegeben. Damit konnten langwierige Verkaufsverhandlungen, über die OnlineReports schon vor Monaten berichtete, erfolgreich beendet werden. Ixos ist ein im Bereich Dokumenten-Management weltweit tätiger Konzern mit Sitz in München. Die Firma, an der Deutschen Börse und an der Nasdaq kotiert, hält in den USA eine starke Position und ist im SAP-Umfeld gut platziert. Damit erhält Obtree eine starke Expansions-Chance und den Zugang zu grossen internationalen Märkten, deren Erschliessung bisher am Vertrieb scheiterte. Der Verkaufspreis beträgt nach Angaben von Ixos-CEO Robert Hoog 7,7 Millionen Franken. Hoog versprach, sämtliche Obtree-Mitarbeiter zu übernehmen. Drei der fünf Verwaltungsräte der neuen Tochtergesellschaft werden Ixos-Leute sein, von Obtree-Seite her bleibt Rolf Brugger Präsident und der bisherige CEO Frank Boller Mitglied. Boller wird auch Geschäftsleiter bleiben und weltweit für die Verbreitung des Produkts verantwortlich sein. Verschwinden wird mit dem Verkauf der Obtree dagegen bald das Logo - insbesondere vom Hauptsitz im grünen Glashaus am Basler Bahnhof.
Obtree hat Monate der massiven Restrukturierung und Sparprogramme hinter sich. Die Stimmung in der Firma ist entsprechend. Mitarbeitende erklären sich froh, dass nun nach Monaten der Ungewissheit eine Entscheidung geroffen worden sei. Laut Boller hat Obtree vergangenes Jahr erfreulich gearbeitet: Der Umsatz sei von 10,8 auf 17,5 Millionen Franken gestiegen und der Break-even sei so gut wie erreicht. Ebenso seien 90 neue Kunden gewonnen worden. (24. Januar 2003)
• Novartis 2002: Die Löhne, die Gewinne, der Umsatz
BASEL. - Erstmals hat der Basler Pharmakonzern Novartis im heute veröffentlichten Jahresbericht die detaillierten Gehälter der Konzernleitung deklariert. Seine 20-Millionen-Bombe (drei Millionen in Cash, 17 Millionen in Aktionen und Optionen) liess Konzernchef Daniel Vasella schon einige Tage früher platzen - wohl um sie nicht zum Hauptgesprächsthema der Pressekonferenz in Zürich zu machen.
Die Jahresbezüge in Millionen Franken:
| Daniel Vasella Präsident und CEO |
20,158 |
| Thomas Ebeling Pharma-Chef |
6,077 |
| Raymund Breu Finanz-Chef |
4,534 |
| Urs Bärlocher Chef Rechtsdienst |
2,437 |
| Norman C. Walker Personal-Chef |
1,804 |
| Paul Choffat Chef Consumer Health |
0,906 |
• Novartis 2002 erneut mit Rekordergebnis
BASEL/ZÜRICH. - Der Basler Pharmakonzern Novartis verzeichnet zum sechsten Mal seit Gründung ein Rekordergebnis, wie heute an einer Pressekonferenz in Zürich bekannt wurde: Der Reingewinn stieg vergangenes Jahr um 4 Prozent auf 7,3 Milliarden Franken, der Konzernumsatz stieg auf 32,4 Milliarden Franken (+11 Prozent in lokalen Währungen oder 2 Prozent in Schweizer Franken). Ausschlaggebend für das starke Ergebnis sind erhebliche Volumensteigerungen in den Sektoren Pharma und Generika. Zehn Prozentpunkte des Umsatzwachstums kamen durch Volumensteigerungen zustande, ein weiterer Prozentpunkt durch Preissteigerungen. Der negative Währungseinfluss von neun Prozentpunkten wegen der anhaltenden Stärke des Schweizer Frankens, der das Umsatzwachstum in Schweizer Franken auf 2 Prozent drückte, konnte dadurch mehr als wettgemacht werden. Das Hauptgeschäft Pharma erzielte einen Umsatz von 21 Milliarden Franken (+13 Prozent in lokalen Währungen), wobei der Generikabereich um 25 Prozent zulegte. Laut Konzernchef Daniel Vasella konnte Novartis mit der Pharmadivision die Führungsposition weiter ausbauen. Dies insbesondere aufgrund von starkem Wachstum in den Bereichen Herz-Kreislauf und Onkologie.
• An der Medienkonferenz kam auch aus , dass Novartis innerhalb der letzten eineinhalb Jahre kräftig Roche-Aktien zugekauft hat und nun über 32 Prozent der Roche-Papiere verfügt. Vasella entwickelte bei der Vorstellung einer erneuten Fusion einen schwärmerischen Eindruck.
• Die Gewerkschaften VHTL und Unia äusserten am Donnerstag scharfe Kritik an Vasellas Jahressalär von 20 Millionen Franken. Bezüge solcher Grössenordnungen seien Ausdruck einer "Amerikanisierung" der schweizerischen Lohnpolitik und "durch nichts gerechtfertigt". (23. Januar 2003)
• Basler SVP weist Schuld an möglichem Wahl-Desaster zu
BASEL. - Scharfe Töne schlägt der Basler Grossrat und SVP-Vizepräsident Berhard Madörin an: Die SVP werde mit einem "eigenen valablen Kandidaten" - damit ist Madörin selbst gemeint, wie er OnlineReports bestätigte - zur Ständeratswahl vom kommenden Herbst antreten. Dies vor dem Hintergrund, dass die Liberalen, Freisinnigen und insbesondere die Christdemokraten nicht zu einer Listenverbindung mit der SVP bereit seien. Der Preis, auf eine SVP-Ständeratskandidatur zur verzichten und statt dessen einen bürgerlichen Kandidaten aus den Parteien LDP, FDP oder CVP zu unterstützen, sei eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen. Dies, um den Sitz des vor vier Jahren gewählten Jean Henri Dunant zu sichern. Diese Allianz sei "politisch opportun" und aus einer Bündelung der bürgerlichen Kräfte könnte ein "Doppelerfolg" hervorgehen: Ein bürgerlichen Ständerat und drei bürgerliche von künftig fünf Basler Nationalräten. Mit diesen Aussagen, die OnlineReports in Form eines als "Pressecommuniqué" deklarierten Leserbriefs vorliegen, setzt Madörin die bürgerlichen Parteien gehörig unter Druck: "Sollten die CVP-LDP-FDP kein Interesse an einer Bindung haben, und müsste die SVP mit aller Konsequenz ihre Kandidaten durchziehen, so läge die Verantwortung für ein allfälliges politisches Desaster nicht bei der SVP, sondern eindeutig bei der abweisenden Allianz." Gleichzeitig versucht Madörin, einen Keil zwischen die drei bürgerlichen Verbündeten zu treiben, indem er fragt, "ob die FDP und LDP mit der CVP ihren politisch richtigen Verbündeten gewählt haben".
Madörins politisches Powerplay ist indes nicht ohne Widersprüche: Wenn er die bürgerliche Regierungsparteienallianz wegen ihrer Distanz zur SVP kritisiert, darf nicht unerwähnt bleiben, dass die SVP an dieser Isolierung zumindest nicht unbeteiligt ist. So wurden kürzlich der liberale Erziehungsdirektor Chrstoph Eymann zum Regierungspräsidenten und der freisinnige Polizeidirektor Jörg Schild zum Vizepräsidenten gewählt - ohne die Stimmen der SVP.
FDP-Parteipräsident Urs Schweizer erklärte gegenüber OnlineReports, Madörin habe "grundsätzlich recht damit, dass mit bürgerlicher Geschlossenheit drei von fünf Sitzen an Land zu ziehen seien". Intensive Hochrechnungen hätten aber ergeben, dass eine Listenverbindung allein den bürgerlichen Sieg nicht garantiere, vielmehr müsste unter allen vier Parteien auch ein geschlossener Wahlkampf geführt werden können. Die SVP sei "allein in der Lage, ihren Nationalratssitz-Sitz zu halten". Schweizer liess erkennen, dass die FDP für eine Allianz mit der SVP zu haben wäre, nicht aber die CVP. Zwar habe die FDP auch schon Szenarien ohne die CVP durchgerechnet, "aber die Freisinnigen und die Liberalen brauchen die CVP". Für die Freisinnigen tritt Nationalrat Johannes Randegger nochmals als, für die Liberalen Christine Wirz-von Planta. Unklar ist, wer sich bürgerlicherseits in den Ständeratswahlkampf schicken lassen will. Polizeidirektor Jörg Schild glänzt zwar regelmässig mit guten Wahlergebnissen, könnte aber mit dem Doppelmandat an öffentlicher Gunst einbüssen. (22. Januar 2003)
• Ernst Beyeler ruft zum Schutz des bolivianischen Tropenwaldes auf
BASEL. - Der Basler Kunstförderer Ernst Beyeler und seine vor einem Jahr gegründete "Stiftung für den Tropenwald" hatten mit dem "Art Club" ins Beyeler-Museum gerufen, gegen 100 Interessierte waren am Dienstagabend gekommen, um sich den Vortrag von Roger Landivar (39, Bild) zu einem der drängendsten bolivianischen Umweltschutzprobleme anzuhören: "Das Pantanal muss geschützt werden". Der Direktor des WWF Bolivien sprach nach einer Einleitung von Ernst Beyeler und der Vorstellung durch Christian A. Meyer, Direktor des Naturhistorischen Museums Basel, über das grösste Feuchtgebiet der Erde (90'000 km2), dessen Probleme und die Arbeit des WWF. Das wasserreiche Ökosystem mit seinen über 200 Fischarten, 300 Vogel- und 45 Reptilienarten wird mehr und mehr bedroht von Viehzüchtern, Minenkonzernen, Rodungen, Wilderei, Fischern, zunehmenden Buschfeuern, Erschliessungsprojekten und der Landwirtschaft, deren Produkte auf dem vom Ausbau bedrohten Rio Paraguay auf den Weltmarkt gebracht werden sollen. Dagegen wehrt sich der WWF, wie auch gegen die Brandrodungen und für Gesetze, welche die Fischerei regeln und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Tropenholz fordern. Wie beim WWF leider üblich, ging auch Landivar - früher Geologe für Ölfirmen - zwar auf Fauna und Flora, nicht aber auf die Situation der im Pantanal lebenden Ureinwohner ein. Ernst Beyeler rief die teils gut betuchten Zuhörer auf, sich auch für das Pantanal zu engagieren. "Es ist schön, wenn Kunst gestiftet wird, aber man kann auch eine Villa oder einen Häuserblock spenden", sagte Beyeler mit einem Augenzwinkern. Es sei gut, wenn sich der Bazillus des Waldschutzes verbreite. Schliesslich gab der Mäzen erfreut bekannt, dass Roche-Erbe und Solarenergiepionier Luc Hoffmann das Ehrenpräsidium des "Stiftung Kunst für Tropenwald" angenommen habe. (22. Januar 2003)
• Basel als Renten-Paradies: Mehr IV-Bezüger als im Rest der Schweiz
BASEL. - Der Kanton Basel-Stadt scheint ein Eldorado für Invaliden-Renten zu sein: Laut einem Bericht der NZZ am Sonntag haben im vergangenen Jahr 8,7 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons eine IV-Rente bezogen. Der schweizerische Durchschnitt dagegen liegt bei 4,9 Prozent. So komme der Kanton Genf auf 4,9 Prozent, der Kanton Zürich sogar nur auf 4,4 Prozent. Nach dem Zeitungsbericht ist für die rekordhohen Basler Rentenausschüttung nicht der hohe Anteil an alten Menschen, Arbeitslosen und Ausländern sowie die grosse Ärztedichte ausschlaggebend. "Andere Städte haben deutlich tiefere Rentnerquoten als als Basel", zitiert die Zeitung Beatrice Breitenmoser, Vizedirektorin des Bundesamtes für Sozialversicherung und frühere Basler SP-Regierungsratskandidatin, welche die Basler Werte als "unerklärbares Phänomen" bezeichnet. Angesichts der wachsenden Defizite der IV-Rentenversicherung wäre wünschenswert, wenn das Basler "Phänomen" erklärbar würde. OnlineReports sind Fälle bekannt, in denen gutsituierte Einwohner Renten beziehen, oder Einzelpersonen, die nach Angaben von Freunden "kerngesund" seien. Die Frage steht im Raum, ob Ärzte, Psychiater und weitere Gutachter allzu bereitwillig Rentenfähigkeit diagnostizieren. (19. Januar 2003)
• Universitäts-Beiträge: Vorpreschen der SP verhärtet die Fronten
LIESTAL/BASEL. - Massive Kritik am Baselbieter Erziehungsdirektor Peter Schmid und der von ihm unterstützten Resolution der SP Baselland, die Beiträge an die Universität Basel massiv zu erhöhen. Der Hersberger FDP-Landrat Patrick Schäfli will in der Fragestunde vom kommenden Donnerstag wissen, wie es komme, "dass sich ein amtierendes Regierungsmitglied öffentlich für zusätzliche Zahlungen ausspricht, obwohl die zuständige Gesamtregierung in dieser Frage noch keine Beschlüsse gefasst hat". Schäfli will zusätzlich wissen, wo die Zusatzbeteiligung in Finanzplan und Regierungsprogramm vorgesehen sei, und ob mit der Resolution nicht die Verhandlungsposition des Baselbiets gegenüber Basel-Stadt geschwächt werde.
Auch SVP-Landrat Dieter Völlmin wird Fragen stellen, die der Regierung Gelegenheit zu einer klaren Stellungnahme ermöglichen. So will Völlmin wissen, ob Schmids Äusserungen auf einem Regierungsrtsbeschluss basieren, und ob die Regierung von den öffentlichen Bekanntmachungen des Erziehungsdirektors gewusst habe.
Gegenüber OnlineReports erklärte Finanzdirektor Adrian Ballmer (FDP), er sei durch die Resolution "überrascht" worden. Die Resolution platze in eine Phase, in der die Verhandlungen mit Basel-Stadt im Gange seien. Die Regierung habe noch keinen Beschluss gefällt. Angesichts des sich abzeichnenden strukturellen Defizits in der laufenden Rechnung von 40 bis 50 Millionen Franken müsse man ihm "erklären, wo wir im Ernst noch sparen können". Baselland stelle weniger als 30 Prozent der Studierenden, zahle aber mit 96 Millionen Franken heute schon 36 Prozent der Universitäts-Kosten. Es sei "tendenziös", so Ballmer, wenn Uni-Präsident Rolf Soiron erkläre, Baselland stelle 55 Prozent der Studierenden und Basel-Stadt 45 Prozent, doch die Finanzierung sei gerade umgekehrt.
Auch die Baselbieter Jungfreisinnigen kritisieren die baselstädtische Zahlenspiele. Immer wieder werde das Baselbiet "als Profiteur Basels dargestellt". Diese Meinung sei "in der Bevölkerung leider auch weit verbreitet. Die Zahlen und der Kosten/Nutzen-Effekt sprechen aber meist eine andere Sprache". Die Jungfreisinnigen Baselland erwarten, dass in Zukunft mit Zahlen und Umständen sorgfältiger umgegangen werde. Dies sei wichtig, "möchte Basel-Stadt sein Vertrauen in der Politik und der Bevölkerung nicht weiter verspielen".
Ausgelöst wurde der neuste Streit durch eine kürzliche Resolution der Baselbieter SP-Delegierten. Sie will, dass der Kanton wesentlich höhere Beiträge an die Universität Basel zahlt. Dies beschloss die Partei diese Woche in einer Resolution an der Delegiertenversammlung in Reinach. Für die nächste Planungsperiode, so die Forderung, soll eine anteilmässige Beteiligung im Verhältnis von 60 Prozent (Basel-Stadt) zu 40 Prozent (Basel-Landschaft) erreicht werden. Dieser Entwicklungsschritt bedeute aus heutiger Sicht eine Beitragserhöhung durch den das Baselbiet um 19 Millionen Franken. (17. Januar 2003)
• 100'000 Franken fehlen: Neues Kleinbasler Hotel "Balade" in Finanznöten
BASEL. - Das vor einem Jahr neu eröffnete "Balade" steckt in finanziellen Schwierigkeiten: Die Betreiber suchen 100'000 Franken. Dies geht aus einem Brief an "Freunde und Bekannte" hervor, der OnlineReports vorliegt. Danach ist der Finanzbedarf dringend: Bis Mitte Februar muss die Finanzspritze auf dem Tisch liegen. Als Begründung führen die beiden Betreiber Peter "Sugo" Sutter, der frühere Wirt des bekannten "Goldenen Fass", und Franz Leugger eine unerwartete Umfeld-Entwicklung ins Feld. Der Start des mit 24 Zimmern ausgestatteten Hotels mit Restaurantbetrieb sei erfolgreich verlaufen, aber dann - mangels Messen - in eine saisonbedingte Flaute geraten. Im weiteren Verlauf sei das Hotel wieder gut ausgelastet gewesen, das Restaurant dagegen habe im Vergleich zu den Frühjahrsmonaten einen Einbruch von 40 Prozent hinnehmen müssen. Zwar habe der Umsatz in den letzten beiden Monaten wieder angezogen, doch sei es nicht gelungen, die Budgetziele zu erreichen. Obschon im Laufe des Jahres die Personalkosten reduziert worden und im Budget 2003 zusätzliche kostensenkende Massnahmen vorgesehen seien, sei der Liquiditätsengpass nicht zu vermeiden gewesen. Sutter und Leugger weisen darauf hin, dass das Projekt in der wirtchaftlichen Hochblüte vor vier Jahren mit hohem Risiko gestartet worden sei. Bei der Eröffnung im Janauar 2002 sei "die Realität aber eine andere" gewesen und die Perspektiven hätten sich nicht verbessert. Zudem habe die Stillegung und das Exil des Kulturbetriebs in der "Kaserne", der eigentlich als Synergiebetrieb betrachtet worden sei, die Rahmenbedingungen zusätzlich verschlechtert.
Das Totenglöcklein freilich läutet noch nicht. Franz Leugger, für das Hotel zuständiger Geschäftsführer, zeigte sich gegenüber OnlineReports optmistisch, dass die 100'000 Franken aufgebracht werden können. Was geschehe, wenn dies nicht gelinge, "kann ich nicht sagen". Jedenfalls sei der Ausblick für dieses Jahr "erfreulich", heisst es im Brief an potenzielle Geldgeber weiter. Das Hotel sei an der Fasnacht und während sämtlichen Messen bis zur Igeho im November ausgebucht. Zudem sei zusätzlich in Marketing- und Eventaktivitäten investiert worden. (16. Januar 2003)
Konkurs
Wind um AKW-Ausstieg: Rechsteiner in der Höhle des Löwen
VON PETER KNECHTLI
BASEL. - Die Debatte um die Zukunft der fünf Schweizer Atomkraftwerke ist neu entflammt: An einem von über 400 Zuhörenden verfolgen kontroversen Diskussion des "Gesprächskreises Energie und Umwelt" am Mittwochabend im Basler Kongresszentrum blieben die Standpunkt von AKW-Befürwortern wie Gegnern kontrovers. Mit der Abstimmung über zwei Volksinitiativen am 18. Mai fällt das Schweizer Volk einen Richtungsentscheid.
Zur Debatte stehen die Volksinitiative "Strom ohne Atom" sowie "Moratorium plus", die beide im Kern den Ausstieg der schweizerischen Energiepolitik aus der Atomenergie zum Ziel haben. Um diese beiden Volksbegehren ging es am Podium, das die vier regionalen Elektrizitätsunternehmen EBM, EBL, IWB und Atel veranstalteten. Es ist immerhin bemerkenswert, dass die traditionell kernkraftfreundlichen Unternehmen mit SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner (Bild rechts) dem wohl schärfsten - und mitunter auch arrogantesten - Kritiker der Atomkraft in
 der Schweiz ein prominentes Forum boten. Die Folge war eine spannende Auseinandersetzung, die deutlich die unterschiedlichen Ansätze herausschälte.
der Schweiz ein prominentes Forum boten. Die Folge war eine spannende Auseinandersetzung, die deutlich die unterschiedlichen Ansätze herausschälte.Laut Rechsteiner, der sofort messerscharf auftrat ("Atomkraft tötet") und seine Podiumsteilnehmer aggressiv in die Kompetenzmangel nahm, müssten die Schweizer Atomkraftwerke aus Sicherheitsgründen schon heute "sofort geschlossen" werden. Anspielend auf Unfälle, Katastrophen oder potenzielle Terror-Attacken sagte Rechsteiner: "Wir wollen die Atomkraftwerke schliessen, bevor ein Unfall passiert. Es ist höchste Zeit, diese Schweinerei zu beenden." Zudem könne sich die Atomenergie ("Planwirtschaft"), in die "kein Privater investieren würde", in offenen Märkten nicht durchsetzen: "Wo der Markt geöffnet wird, wird aus der Atomenergie ausgestiegen." Rechsteiner kritisierte auch die Schweizer Parlamentsmehrheit, die im neuen Atomgesetz die Mitsprache der Kantone streichen wolle und die Schaffung eines Krebsregisters zur Erfassung der Krebskranken rund um Atomanlagen verhindern wolle. Statt dessen setzte der promovierte Basler Ökonom auf die Wind-Energie als "billigste Stromerzeugungstechnik". Die Windkraft wachse mit 28 Prozent "so schnell wie das Internet".
Dies war einer der Ansatzpunkte, mit denen die Gegner der Ausstiegs-Initiativen ihrem verbalrabiaten Kritiker ans Leder gingen. Noch vor einigen Jahren habe Rechsteiner die Photovoltaik propagiert, jetzt seien plötzlich die Windfarmen das alternative Allerheilmittel, sagte etwa der Basler Ökonomieprofessor Silvio Borner, der die Kosten eines Ausstiegs ("eine Kapitalvernichtung") auf mehrere Dutzend Milliarden Franken schätzte. Borner wandte sich nicht prinzipiell gegen Wind und Solarenergie, pries die Kernkraft aber als "natürliche Verbündete der Alternativenergien", weil sie zuverlässige Grundlast liefere. Zudem sei die Kernenergie die einzige Energieart, die ihre Entsorgung vorfinanziere. Rechsteiner konterte darauf, die Endlagerung erfordere eine Kontrolle von 100'000 Jahren: "Das sind unmenschliche Zeiträume."
Der ETH-Professor Wolfgang Kröger, Direktionsmitglied des Paul Scherrer Instituts, betonte, die Kernenergie sei "kein Auslaufmodell". Weltweit seien 440 Anlagen in Betrieb, vor allem im asiatischen Raum werde stark ausgebaut. Die Atomenergie ("eine Erfolgsstory") sei "faktisch sicher", habe kein Ressourcenproblem, sei frei von C02-Emissionen und die Endlagerung sei "technisch machbar". Die Windenergie dagegen leiste nur einen kleinen Beitrag zur Stromversorgung; problematisch sei es, Windmühlen in der Ostsee aufzustellen, wie es Rechsteiner vorschlug: "Wir müssen da in die Naturschutzgebiete rein." In einem Publikumsvotum wurde Rechsteiner vorgeworfen, die Transportprobleme des Stromtransfers von der Nord- und Ostsee in die Schweiz zu verkennen.
Hans Luzius Schmid (Bild links), der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Energie, erläuterte, weshalb der Bundesrat die beiden Initiativen ablehne und die "Option Kernenegie offen halten will". Ohne Atomstrom könnten die CO2-Ziele nicht eingehalten werden. Schmid räumte ein, dass "Alternativen zu Kernkraftwerken bestehen"; es brauche aber Zeit und Geld, um sie zu entwickeln. Auf eine Frage aus dem Publikum nach der Höhe der staatlichen Forschungsbeiträge für die Atomenergie und die einheimische erneuerbare Energie konnte Schmid keine Zahlen nennen.
Die Diskussion zeigte, dass sich AKW-Gegner und Kernenergiebefürworter seit den letzten grossen Auseinandersetzungen in ihren Standpunkten kaum angenähert haben. Die spannende kontradiktorische Debatte machte mindestens Gesprächsfähigkeit deutlich - und das ist nicht wenig. (16. Januar 2003)
|
ECHO |
|
"Das 100'000-jährige Reich"
Die Arroganz der Atomlobby ist nicht mehr zu überbieten: Das 1000-jährige Reich hatten wir schon, jetzt wird wegen der Atomabfälle das 100'000-jährige propagiert - entlarvend-degoutant! Dieter Stumpf-Sachs |
• Marketing-Chef Arjen Pen verlässt die "Swiss"
BASEL. - Wechsel an der Spitze des Flugunternehmens "Swiss": Geschäftsleitungsmitglied Arjen Pen (32), Leiter Marketing und Verkauf, verlässt die Firma "auf eigenen Wunsch", wie Swiss mitteilt. Pen sehe nach der Ernennung von William L. Meaney zum kommerziellen Direktor und nach angekündigten Umstellungen in der Organisation "keine Zukunft mehr" bei "Swiss". CEO André Dosé bedauert den Abgang des initiativen Kadermannes sehr, habe er doch "in der turbulenten Aufbauphase Ausserordentliches geleistet". Die Geschäftsleitung, so heisst es weiter, schlage dem Verwaltungsrat "verschiedene Veränderungen in den kommerziellen Divisionen" vor von denen "eine schnellere Umsetzung der Strategie" erhofft werden. Unterschiedliche Auffassungen über diese Massnahmen seien es gewesen, die Pen zur Kündigung veranlasst hätten. - Der Betriebswirtschafter Pen stiess 1999 als Verkaufsdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung zur Crossair. Zuvor war während sechs Jahren bei der Lufthansa, wo er zuletzt Marketing und Vertrieb Europa West/Süd in Paris geleitet hatte. (15. Januar 2003)
• Anwiler Jagdpanne bleibt ohne strafrechtliche Folgen
LIESTAL/ANWIL. - Der brutale Tod eines durch die Jagdgesellschaft Anwil getriebenen Rehs im Herbst 2001 bleibt ohne strafrechtliche Folgen: Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat den Fall rechtskräftig eingestellt, wie Staatsanwältin Caroline Horny gegenüber OnlineReports bestätigte. Damit folgte die Staatsanwaltschaft dem Antrag des Statthalteramtes Sissach. - Während einer Treibjagd war das Reh mit einer Schrotladung angeschossen worden, worauf es bei seiner Flucht unterhalb des Anwiler Weihers in die Ergolz stürzte. Der Jagdleiter schoss darauf dem Tier mit zwei weiteren Schüssen in die Hals- und Brustgegend. Als es immer noch zuckte, drückte ihm ein in der Nähe anwesender Arbeiter den Kopf unter Wasser. Laut der Staatsanwältin handelte es sich zwar um einen "Fehlschuss" des Jägers ("den kann es geben"), doch könne "weder ihm noch dem Jagdleiter strafrechtliches relevantes Verhalten nachgewiesen werden". Es habe sich beim Vorfall weder um Fahrlässigkeit noch um Vorsatz gehandelt. Nach den beiden Schüssen des Jagdleiters auf im Fluss liegende Reh sei es "nerventot" gewesen und sei demzufolge nicht durch Ertränken gestorben. (13. Januar 2003)
Zurück zur Hauptseite
![]()
© Copyright by Peter Knechtli und den Autorinnen und Autoren.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar
und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Design by Computerschule121
 bekannt.
Gleichzeitig zogen die Nationalräte Ruedi Rechsteiner (2.
von rechts) und Remo Gysin (rechts) "im Sinne einer Aufgabenteilung"
ihre Ständeratskandidaturen zurück. "Unser Platz ist im
Nationalrat." Auch Grossratspräsident Leonhard Burckhardt
(links) erklärte seinen Verzicht auf eine Ständeratskandidatur.
Damit fokussiert sich die SP auf klar auf Anita Fetz, die sich für
das Vertrauen bedankte, aber gleichzeitig betonte, "dass dies nicht
heisst, dass ich schon nominiert bin". Ein Spaziergang werde der
Wahlkampf nicht werden, sie sei aber "sehr zuversichtlich",
dass er zugunsten der SP Basel-Stadt" ausgehe - einer SP, die "in
Bern über eines der stärksten Teams verfügt". Mit
welchen Inhalten sie das Amt in der Kleinen Kammer füllen möchte,
wolle sie erst bekannt geben, wenn sie nominiert werde. Nur soviel: "Ich
verstehe mich als Botschafterin für den Kanton und seine Bevölkerung
in der Tradition der SP-Ständeräte für ein soziales und
weltoffenes Basel. Ich möchte die weltoffenen und städtischen
Kräfte stärken." Die 45jährige Politikerin zeigte
sich siegesgewiss: Sie freue sich auf den Wahlkampf. Gleichzeitig bedauerte
sie, dass auch der potenzielle FDP-Kandidat Jörg Schild ("mein
Lieblingsgegner") seinen Verzicht auf eine Gegenkandidatur bekannt
gegeben habe. "Es wäre spannend geworden."
Die designierte Ständeratskandidatin will mit Gysin, Rechsteiner
und Burckhardt sowie einer weiteren namentlich noch nicht bekannten Bewerbung
auch für den Nationalrat kandidieren: "Wir sind fest entschlossen,
die drei Sitze zu verteidigen." Laut Parteipräsident und Grossrat
Beat Jans dürfte die SP auch bei fünf statt sechs Basler
Nationalrats-Mandaten immer noch knapp drei Sitze erringen - wobei der
dritte bedrohlich wackelt. Nominiert wird Mitte Mai. (24.
Februar 2003)
bekannt.
Gleichzeitig zogen die Nationalräte Ruedi Rechsteiner (2.
von rechts) und Remo Gysin (rechts) "im Sinne einer Aufgabenteilung"
ihre Ständeratskandidaturen zurück. "Unser Platz ist im
Nationalrat." Auch Grossratspräsident Leonhard Burckhardt
(links) erklärte seinen Verzicht auf eine Ständeratskandidatur.
Damit fokussiert sich die SP auf klar auf Anita Fetz, die sich für
das Vertrauen bedankte, aber gleichzeitig betonte, "dass dies nicht
heisst, dass ich schon nominiert bin". Ein Spaziergang werde der
Wahlkampf nicht werden, sie sei aber "sehr zuversichtlich",
dass er zugunsten der SP Basel-Stadt" ausgehe - einer SP, die "in
Bern über eines der stärksten Teams verfügt". Mit
welchen Inhalten sie das Amt in der Kleinen Kammer füllen möchte,
wolle sie erst bekannt geben, wenn sie nominiert werde. Nur soviel: "Ich
verstehe mich als Botschafterin für den Kanton und seine Bevölkerung
in der Tradition der SP-Ständeräte für ein soziales und
weltoffenes Basel. Ich möchte die weltoffenen und städtischen
Kräfte stärken." Die 45jährige Politikerin zeigte
sich siegesgewiss: Sie freue sich auf den Wahlkampf. Gleichzeitig bedauerte
sie, dass auch der potenzielle FDP-Kandidat Jörg Schild ("mein
Lieblingsgegner") seinen Verzicht auf eine Gegenkandidatur bekannt
gegeben habe. "Es wäre spannend geworden."
Die designierte Ständeratskandidatin will mit Gysin, Rechsteiner
und Burckhardt sowie einer weiteren namentlich noch nicht bekannten Bewerbung
auch für den Nationalrat kandidieren: "Wir sind fest entschlossen,
die drei Sitze zu verteidigen." Laut Parteipräsident und Grossrat
Beat Jans dürfte die SP auch bei fünf statt sechs Basler
Nationalrats-Mandaten immer noch knapp drei Sitze erringen - wobei der
dritte bedrohlich wackelt. Nominiert wird Mitte Mai. (24.
Februar 2003) Pläne
wurden den Medien am Dienstag im Beisein des Basler Wirtschaftsministers
Ralph Lewin vorgestellt. - Die Diener&Diener Architekten versprechen
ein "originelles Einkaufszentrum" auf einer Fläche von
37'000 Quadratmetern, das eine grosszügige überdeckte Shopping-Promenade
enthält. Zu diesem Komplex gehört zusätzlich ein Dreisterne-Hotel
mit 150 Doppelzimmern sowie 9'500 Quadratmetern Bürofläche.
Der gesamte Komplex soll in Kleinhüningen mehr als 650 neue Arbeitsplätze
schaffen und mit einer 820 Parkplätze fassenden Tiefgarage ausgestattet
werden. Der "Science-Park" von Blaser Architekten soll phasenweise
realisiert werden. Das lang gestreckte Gebäude (rechtes Bild hinten)
soll 1'000 Arbeitsplätze bieten, der Bezug der ersten Räumlichkeiten
ist auf 2005 vorgesehen. Der Bau von "bis zu vier" quer liegenden
Gebäuden mit Sockelbauten und 290 Parkplätzen ist zu einem späteren
Zeitpunkt vorgesehen. - Regierungsrat Lewin gratulierte der Bauherrin
Tivona für ihr "antizyklisches Verhalten", ihr "unternehmerisches
Risiko" und ihren "Mut". Das Projekt entspreche auch den
Absichten des Wirtschafts- und Sozialdepartementes, vermehrt Laborräume
kombiniert mit Büroflächen in einer innovationsfördernden
Umgebung entstehen zu lassen. - Das Projekt hat in seiner bisherigen Entstehungsgeschichte
vor allem wegen seiner unmittelbaren Nähe zum
Pläne
wurden den Medien am Dienstag im Beisein des Basler Wirtschaftsministers
Ralph Lewin vorgestellt. - Die Diener&Diener Architekten versprechen
ein "originelles Einkaufszentrum" auf einer Fläche von
37'000 Quadratmetern, das eine grosszügige überdeckte Shopping-Promenade
enthält. Zu diesem Komplex gehört zusätzlich ein Dreisterne-Hotel
mit 150 Doppelzimmern sowie 9'500 Quadratmetern Bürofläche.
Der gesamte Komplex soll in Kleinhüningen mehr als 650 neue Arbeitsplätze
schaffen und mit einer 820 Parkplätze fassenden Tiefgarage ausgestattet
werden. Der "Science-Park" von Blaser Architekten soll phasenweise
realisiert werden. Das lang gestreckte Gebäude (rechtes Bild hinten)
soll 1'000 Arbeitsplätze bieten, der Bezug der ersten Räumlichkeiten
ist auf 2005 vorgesehen. Der Bau von "bis zu vier" quer liegenden
Gebäuden mit Sockelbauten und 290 Parkplätzen ist zu einem späteren
Zeitpunkt vorgesehen. - Regierungsrat Lewin gratulierte der Bauherrin
Tivona für ihr "antizyklisches Verhalten", ihr "unternehmerisches
Risiko" und ihren "Mut". Das Projekt entspreche auch den
Absichten des Wirtschafts- und Sozialdepartementes, vermehrt Laborräume
kombiniert mit Büroflächen in einer innovationsfördernden
Umgebung entstehen zu lassen. - Das Projekt hat in seiner bisherigen Entstehungsgeschichte
vor allem wegen seiner unmittelbaren Nähe zum  OnlineReports: Wie könnte eine staatliche Förderung von ergänzenden Online-Informationsmedien konkret aussehen?
OnlineReports: Wie könnte eine staatliche Förderung von ergänzenden Online-Informationsmedien konkret aussehen?
