Tipp für
Stories | Hier werben | Story
übernehmen

Wollen Sie Freunde oder Bekannte auf diesen Artikel aufmerksam machen?
Oben auf das kleine "Briefchen"-Symbol klicken.
© Foto by OnlineReports.ch
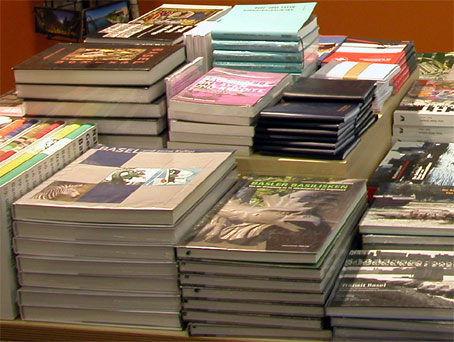
"Ausgleich der Interessen": Kulturgut Buch
"Exception culturelle": Kultur ist keine Ware
Die Unesco setzt sich dafür ein, dass Kulturgüter von den Regeln des Weltmarktes ausgenommen werden
VON AUREL SCHMIDT
Die Buchpreisbindung ist ein kontroverses Thema. Der feste Ladenpreis macht Bücher zwar teurer, garantiert dafür aber eine gewisse Handlungsfreiheit der Buchbranche und damit die Diversität der Buchproduktion. Die Marktregulierung passt aber vielen nicht. In einem Artikel am 21. Oktober 2005 unternahm die NZZ wieder einmal einen Angriff auf die negative Buchpreisbindung, die angeblich "die hiesigen Konsumenten schröpft" und die Menschen vom Lesen abhält.
Zu glauben, dass mehr Bücher gelesen würden, falls sie weniger kosten sollten, ist ein Märchen. Es stimmt nicht. Lesen ist ein kultureller Akt und hängt von einer bestimmten Lebenseinstellung ab. Wohl könnten einige Bücher, wenn sie verbilligt würden, in noch grösserer Zahl umgesetzt werden, aber das wären Bücher, die sowieso viel gelesen werden wie Besteller und populäre, auflagenstarke Titel.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen findet ein Ausgleich der Interessen statt. Entfiele er, würde das den Harry-Potter-Boom noch mehr anheizen und diejenigen Bücher begünstigen, die mit grossem Etat und Werbeaufwand wie industrielle Massenware produziert und in die Welt gesetzt werden. Dass andere es dann schwerer hätten und einige gar nicht erscheinen könnten, ist eine Erfahrung, die in anderen Ländern gemacht worden ist. Die Standardisierung des Sortiments amerikanischer Buchhandlungen ist ein Beispiel.
"Dem Markt alles zu überlassen,
ist eine Kurzsichtigkeit."
Es ist bezeichnend, dass der Artikel, in dem das angenommene Leserinteresse von der Buchpreisfrage abhängig gemacht wurde, ausgerechnet im Wirtschaftsteil der NZZ erschienen ist und nicht im Kulturteil. Davon abgesehen sollte ein Buch ruhig etwas kosten dürfen. Von "schröpfen" zu sprechen, müsste weit mehr die Erhebung von Bankspesen betreffen.
Alles verdient seinen Preis. Aber heute wird alles einem ökonomischen Diktat unterworfen. Die Gewinne müssen von Jahr zu Jahr steigen, zugleich soll alles billiger werden. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Der Preisdruck schadet der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kultur im Besonderen.
Dem Markt alles zu überlassen, auch Bücher, ist eine Kurzsichtigkeit. Man müsste sich gelegentlich vielleicht einmal vom angesammelten ideologischen Ballast wie etwa der sogenannten Deregulierung und Liberalisierung befreien. Die Berufung auf den Markt ist ein kläglicher Verzicht auf bewusstes und zielorientiertes Handeln. Es gibt nichts einzuwenden, wenn Menschen ihre gemeinsamen Interessen organisieren.
Der Zufall wollte es, dass am gleichen 21. Oktober 2005, an dem die NZZ in (raub)ritterlicher Manier auf die Buchpreisbindung los ging, eine Notiz in den Medien erschien über eine am Tag zuvor in Paris verabschiedete Konvention der Unesco. Dieses völkerrechtlich bindende Abkommen, das von Frankreich und Kanada getragen wurde, sieht den besonderen Schutz bestimmter Kulturgülter vor und wurde mit 148 gegen zwei Stimmen (USA und Israel) angenommen.
Die kulturelle Vielfalt zu bewahren
ist ein ethischer Imperativ."
Die Vielfalt und Verschiedenheit kultureller Ausdrucksformen ist eine Manifestation der Identität von Staaten und Nationen. Umso mehr kommt deren Respektierung und Erhaltung, nach einem Leitsatz der Unesco aus dem Jahr 2001, einem "ethischen Imperativ" gleich.
Die Staaten sollen aus diesem Grund das Recht in Anspruch nehmen können, ihre eigenen kulturellen Güter und Werte zu fördern und zu bewahren. Anders und deutlicher ausgedrückt: Kulturgüter sollen nicht als Waren und Konsumartikel betrachtet und mit der neuen Konvention von den Regeln des Weltmarkts ausgenommen werden. Das ist etwas, das aufhorchen lässt.
"Es ist sinnvoll, den freien Handel
ins richtige Verhältnis zu rücken."
World Trade Organization (WTO) ebenso wie EU-Kommission machen vor nichts Halt und geben keine Ruhe, bis sie alles aufgefressen haben. Die Liberalisierung der Landwirtschaft ist in vollem Gang und im Begriff, aus Nahrungsmittel profitgenerierende Industrieprodukte zu machen; der Dienstleistungssektor steht ganz oben auf der Agenda der Deregulierungstreiber (was in Frankreich wahrscheinlich zur Ablehnung der EU-Verfassung geführt hat); und auch die Kultur droht in die Fangarme der Wirtschaftsraserei zu geraten.
Die Dominanz der ökonomischen Interessen hat eine nivellierende Wirkung, mit dem Ergebnis, dass man am Ende nur noch die Wahl hat zwischen Kartoffelchips und Maischips oder auf dem Buchmarkt, wenn die Preisbindung fallen sollten, zwischen einem Bestseller und einem anderen. Wenn zuletzt kommerzielle Massstäbe den Ausschlag geben, geht verloren, was Sinn und Bedeutung ausmacht.
Durch die Unesco-Konvention sehen die USA ihre Hollywood-und Musikindustrie bedroht, für Wirtschaftsführer stellt sie ein Regelwerk dar, das den "Idealen des freien Handels" (NZZ Online 9. Oktober 2005) zuwider läuft. Ideal oder nicht, aber das ist die erklärte Absicht: Den sogenannten freien Handel ins rechte Verhältnis zu rücken. Kultur ist keine Ware wie Jeans oder Staudämme. Es ist sinnvoll, sie zu schützen.
Wenn 30 Staaten die Konvention ratifiziert haben und sie in Kraft getreten ist, können die Staaten in Zukunft auf ihre Kulturpolitik Einfluss nehmen, auch finanziell, ohne sich dem Einwand der Wettbewerbsverfälschung auszusetzen.
"Exception culturelle und Service public
sind im Allgemeininteresse."
Als "exception culturelle", wie man in Frankreich sagt, wird also eine Sonderregelung für kulturelle Bereiche vorgeschlagen und verteidigt. Ähnlich versucht der Service public, bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen und sozialen Lebens gegen den Willen von WTO und EU vor deren Privatisierung und totaler Kommerzialisierung zu bewahren.
Bei Verkehr, Bildung, Gesundheit, Kultur, Wasserversorgung und zum Beispiel den grossen gebührenfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten bestehen starke Interessen der Allgemeinheit, die vom Aneignungsappetit kapitalkräftiger Investoren ausgenommen zu werden verdienen. Öffentlichkeit ist eine demokratische Forderung.
Cablecom ist jetzt in USA-Besitz übergegangen, die "Berliner Zeitung" in britische Hände. Man stelle sich aber vor, das biedere Schweizer Fernsehen gerate in die Hände eines privaten Investors und sogenannten Sanierers, zum Beispiel eines amerikanischen Waffentechnologie-Konzern oder eines Herrn mit dem Namen Silvio Berlusconi und dessen Weltanschauung – nicht auszudenken. Halten wir uns lieber an eine ebenso sinnvolle wie zweckmässige Ausnahmeregelung.
Ihre Meinung?

|
> ECHO
|
"Buchpreis-Unterschiede sind enorm"
Ich bin für eine sinnvolle Buchpreisbindung. Ich bin dafür, dass der Staat kulturelle Prozesse finanziell unterstützt und damit oft erst ermöglicht. Ich bin dafür, dass der Stadtstaat Basel alle kulturellen Einrichtungen mit Steuergeldern fördert und, wo es notwendig sein mag, im Namen der Freiheit künstlerischer Entwicklungen auch vollständig bezahlt. Ich stimme Aurel Schmidt also zu.
Ein Aber existiert für mich allerdings bezüglich der effektiven Buchpreise oder, allgemeiner formuliert, die effektiven Kulturpreise für Interessierte, die in der Deutschschweiz gelten. Seit einiger Zeit kaufe ich meine Bücher nicht mehr in der Schweiz. Der Preisunterschied zu den Buchpreisen in Deutschland ist enorm und hat mit der Buchpreisbindung wenig bis nichts zu tun. Festzuhalten ist, dass auch in Deutschland die Buchpreisbindung besteht. Wenn ich nun für jedes Buch in einer deutschweizerischen Buchhandlung nach den Vergleichskriterien, welche jeweils der schlichte Kassenbon hergibt, rund 15 bis 20 % mehr bezahlen muss, stellt sich mir die Frage: Weshalb denn das?
Man komme mir nicht mit den angeblich höheren Löhnen. Bei den Löhnen hier zu Lande wird ständig unser "Netto" mit dem "Netto" der Deutschen verglichen, ohne anzufügen, dass das dortige "Netto" dann wirklich das Geld ist, welches man für das Wohnen, das Essen und den allgemeinen Konsum ausgeben kann. In der Schweiz muss man aus dem "Netto" aber erst einmal zusätzlich zu den Sozialabgaben, welche "brutto" sind, seine Steuern und seine Krankenkassenprämien aus dem Nettolohn begleichen, Dinge, die bei deutschen Lohnempfängern in die "Brutto"-Berechnung gehören.
Ich lebe während eines Teils meiner Zeit in Berlin. Mir fällt auf, dass ich mir in jener Stadt mit dem gleichen Geld bedeutend mehr Bücher, Ausstellungskataloge, Kinobesuche, Konzertbesuche, Museumsbesuche, Theater- und Opernaufführungen leisten kann als in Basel. Ein normaler Kinoeintritt in ein Studiokino kostet in Berlin nicht jeden Abend gleich viel. An den teuersten Abenden bezahle ich in den Kant-Kinos, in den Kinos in den Hackeschen Höfen oder in der Kulturbrauerei 7 Euro. Das sind knapp 11 Franken. Wohlverstanden: An den teuersten Abenden, also am Freitag und am Samstag.
Man sieht wohl, wovon ich schreibe. Preisbindung und Preise, die der Konsument bezahlt, auch und gerade der deutschschweizerische Buchkäufer, sind nicht dasselbe. Die Preise sind meiner Ansicht nach sehr wohl einer ständigen kritischen Nachfrage auszusetzen.
Alois-Karl Hürlimann
Basel
|
|
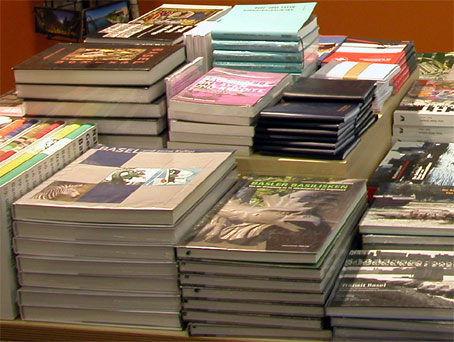

![]()