|
Foto © OnlineReports / Quelle: Lehrmittelverlag Aargau
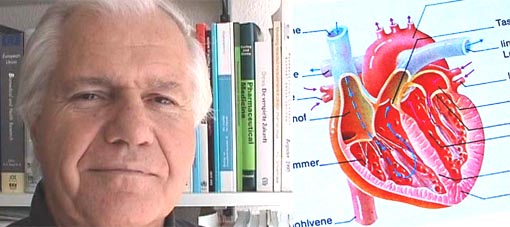
"Vor gewaltigen Herausforderungen": Kardiologe Fritz Bühler, Herz im Querschnitt
Wenn das Herz schlägt, klingelt die Kasse
Bei Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Herzkrankheiten sind Milliarden im Spiel
VON PETER KNECHTLI
Herzkrankheiten sind in der Schweiz die Todesursache Nummer eins - weit vor Krebs. Damit die wundersame menschliche Pumpe nicht plötzlich still steht, werden jährlich Milliarden ausgegeben. Die Zahl der Katheter-Eingriffe und Bypass-Operationen wächst rapide, die Medikamente werden teurer. Im Vergleich zu den Kosten für akute Behandlung sind die Aufwendungen für Prävention und Rehabilitation aber vergleichsweise gering.
"Ich bin topfit." Hugo Saner (53), erster Professor für kardiovaskuläre Prävention und Rehabilitation am Inselspital Bern bemüht sich, "ein Vorbild zu sein": Morgens um fünf Uhr aufstehen, 20 Minuten Home-Trainer beim Betrachten der ZDF-Morgen-News. Ausgedehnte Velotouren, eine "sehr mediterrane Ernährung mit zwei Glas Rotwein zu Abendessen" und "gezielte Entspannungsmassnahmen" runden sein privates Herzgesundheits-Rezept ab.
Längst nicht alle Schweizerinnen und Schweizer halten sich an dieses Modell: Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die häufigste Todesursache, doppelt so häufig wie Krebs. Über 43 Prozent der Frauen und über 38 Prozent der Männer starben 1997 an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. 25'000 Herzinfarkte, 12'000 Herzkatheter-Eingriffe und 5'000 Bypass-Operationen sind nur die statistischen Indizien eines Krankheitsbildes, das volkswirtschaftlich eine Milliarden-Dimension darstellt. Pharmaindustrie, Prävention,
| “Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die häufigste Todesursache - doppelt so häufig wie Krebs.“ |
"Der Herz-Markt in der Schweiz wird weiter wachsen", glaubt der bekannte Basler Kardiologe Fritz Bühler, 61, bis Ende 1995 Chef der weltweiten klinischen Forschung und Entwicklung von Hoffmann-La Roche. Als Grund nennt der Gründer des European Center of Pharmaceutical Medicine die Überalterung der Menschheit und "die absolute Zunahme der Herz-Kreislauf-Krankheiten durch die verwöhnte und verweichlichte Lebensweise" unserer Gesellschaft.
Um so mehr Aktivität entfaltet sich in den Operationssälen: An den fünf Universitätskliniken in Bern, Lausanne, Zürich, Basel und Genf sowie in den zehn öffentlichen nicht-universitären Spitälern und den elf Privatkliniken des Landes wurden 1999 über 9'700 Kathetereingriffe und 4600 Bypassoperationen vorgenommen. Fachleute schätzen, dass es dieses Jahr über 12'000 Kathetereingriffe sein werden.
Herzkathetereingriffe in 13 Jahren verachtfacht
Eine Erhebung der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie belegt, dass sich die Zahl der Herzkathetereingriffe in der Schweiz innerhalb von 13 Jahren mehr als verachtfacht hat. Mit einer fast zweieinhalbfachen Ausweitung entwickelte sich die Zahl der Bypassoperationen. Schwieriger wird es erstaunlicherweise, die Kosten der chirurgischen Eingriffe zu erfahren. Das liegt mindestens auch teilweise an ungenügender Software in den Spitälern. "Ich weiss nicht, was die Kardiologie kostet und was sie bringt",
| “Kathetereingriffe und Bypassoperationen kosten über eine Viertelmillarde Franken.“ |
Nach einer Rechnung von OnlineReports dürften allein Kathetereingriffe und Bypassoperationen heute jährlich weit über eine Viertelmilliarde Franken kosten. Budgetreduktionen in öffentlichen Spitälern und Sparappelle hätten "bislang die Anwendung invasiver und chirurgischer Herzeingriffe nicht reduziert", bilanzieren die Kardiologen. Dies manifestiere "eine vernünftige Einstellung" der Gesundheitsadministratoren und Sozialpolitiker der wichtigsten Krankheit gegenüber.
Ein Tabu sind die massiv steigenden Kosten der Herzbehandlung aber nicht. Der Berner Gesundheitsökonom Klaus Müller argumentiert, dass Bypass wie Katheter nicht die Ursache der Herzkrankheit beseitigen, sondern nur "eventuell bedrohliche Situationen durch einen 'reparativen' Therapieeinsatz für eine gewisse Zeit entschärfen". Durch verstärkte Rehabilitation, so Müller, könnten die Kosten gesenkt werden.
Nur 40 Millionen Franken für Rehabilitation
Gemäss Hugo Saner erzielen die elf stationären Rehab-Kliniken und die rund 25 ambulanten Programme zusammen einen Umsatz von erst gerade 40 Millionen Franken. 9'000 Herzpatienten werden pro Jahr "strukturiert kardial rehabilitiert" - gemäss Saner viel zu wenig: "Dies entspricht etwa 30 Prozent der Patienten, die für eine strukturierte Rehabilitation prinzipiell in Frage kommen." Nach seiner Meinung gibt es in der Schweiz 15'000 Patienten, die "ein Rehab-Programm haben sollten und es nicht bekommen". Grund dafür sei häufig der Stolz der Ärzte, ihre Patienten so schnell wieder auf die Beine gebracht zu haben. Dazu komme der nicht weniger fatale Stolz der Patienten: Der Kathetereingriff wird mit Vorliebe auf Freitag angesetzt, damit am Montag wieder zur Arbeit geschritten werden kann.
Für Saner ist "ganz sicher", dass Rehabilitation ein starker Wachstumsmarkt ist: "Der Trend geht Richtung gesundem Lebensstil - vom Hotel mit herzfreundlicher Ernährung und Bewegungsangebot bis hin zum klassischen Programm." Weil die Herz-Kreislauf-Krankheiten "an Bedeutung weiter zunehmen", könnte sich der Rehab-Markt auf ein Volumen von "mehreren hundert Millionen Franken" entwickeln und damit verzehnfachen.
Medikamente werden teurer
Ob daraus eine Reduktion der Gesundheitskosten resultieren würde, ist für Simonetta Sommaruga, Berner SP-Nationalrätin und Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, fraglich. Die Politik der heutige "Prestigeangebote" - auch im Herzbereich - schaffe die Nachfrage. "Deshalb braucht es zur Planung von Zentren und den Ankauf von Geräten ganz klar eine Bundeskompetenz." Überdies sollen die gesamten
| “Es braucht für Prestigeangebote ganz klar eine Bundeskompetenz.“ |
Das Geschäft mit dem Herzen hat vorläufig noch Konjunktur. Zwar blieb nach Angaben der Pharma-Information die Zahl der verkaufen Packungen an Herz-Kreislauf-Medikamenten mit 13,5 Millionen Stück in den letzten fünf Jahren stabil. Doch erhöhte sich der Umsatz im gleichen Zeitraum von 666 Millionen auf 880 Millionen Franken um ein sattes Drittel.
Roche betreibt keine eigene Herz-Kreislauf-Forschung mehr
"Keine grosse Pharmafirma kann es sich leisten, diese grossen Märkte links liegen zu lassen", weiss der Basler Mediziner Fritz Bühler. Allerdings herrsche "da und dort die Meinung vor, dass diese Indikationsbereiche gesättigt sind".
So betreibt Hoffmann-La Roche seit vier Jahren keine eigene Herz-Kreislauf-Forschung mehr, doch war sie "vorbildlich behilflich" (Bühler), diese Aktivitäten in die unabhängige und weitgehend von ehemaligen Roche-Forschern geführte Firma Actelion zu führen. Das Allschwiler Forschungsunternehmen arbeitet an einigen
| “Novartis ist im Herz-Kreislauf-Bereich aktiver als Roche.“ |
Aktiver als Roche ist Novartis, die einen bedeutenden Teil ihres Pharmaumsatzes mit Herz-Kreislauf-Präparaten erzielt. "Uralte Tradition" hatte dieses Therapiegebiet schon bei der Novartis-Vorgängerfirma Ciba, die aus Fingerhut verschiedene Alkaloide extrahierte und zur Marktreife brachte. Auch sind deren Coramin-Lutschtabletten gegen Herzschwächen noch immer erhältlich. Heutiger Verkaufsleader ist der Blutdrucksenker Diovan: Merrill Lynch schätzt, dass Diovan Ende 2005 um 2,8 Milliarden Franken Umsatz erreichen könnte.
"Speedel" arbeitet an neuem Blutdrucksenker
Eine Verwandtschaft per Lizenz pflegt Novartis mit "Speedel", einer 1998 von Ciba-Fachleuten gegründeten und durch den Novartis Venture Fund unterstützten Pharmaentwicklungsfirma. Das 35köpfige Unternehmen hat nicht nur einen "neuen Syntheseweg gefunden, der tiefere Produktionskosten verspricht" (so der wissenschaftliche Leiter Dieter Scholer), sondern mit Aliskiren auch einen neuartigen Blutdrucksenker im Portfolio, der "eventuell das Potenzial für einen Milliardenumsatz hat". Bei einem Erfolg könnte der Reninhemmer um 2005 auf den Markt kommen, wobei Novartis eine Callback-Option einlösen und Speedel an den Verkäufen beteiligt würde.
Bis es so weit sein wird, sind noch kostspielige Studien, Tests und klinische Erprobung erforderlich. 600 bis 800 Millionen Franken kosten die Vorleistungen in Forschung und Entwicklung eines Medikaments, bevor die erste Pille verkauft ist. Kein Wunder, setzen die Firmen nach Markteröffnung auch verschiedenste Absatzkniffe ein. So gab Novartis Rezeptblöcke mit dem Aufdruck "sic" an Ärzte ab, der die Verschreibung von billigeren Generika verhindert.
Gratis-Muster für Ärzte
Dass Preisabsprachen unter Konkurrenten getroffen werden, verneint ein erfahrener Pharmaforscher ("weil die Anbieter zu zahlreich sind"). Dagegen würden Ärzte "bearbeitet" - auch mit "gewissen Geschenken". So würden selbstdispensierenden Ärzten auch mal "grössere Mengen Muster" gratis überlassen, die sie auf eigene Rechnung verkaufen können. Überdies würden Mediziner gern an nobel aufgezogene Kongresse, vorzugsweise auf Hawaii, eingeladen. Schliesslich komme bei der Lancierung eines neuen Präparats "kein Unternehmen darum
| “Medizinprofessoren werden gern an noble Kongresse eingeladen - vorzugsweise auf Hawaii.“ |
Wie im gesamten Therapiespektrum stehen die Konzerne auch im Herz-Kreislauf-Gebiet "vor gewaltigen Herausforderungen" (Bühler), weil einerseits die Produkteentwicklungen immer komplizierter, sicherheitsbewusster und spezifischer werden, anderseits die Patientengruppen, die dasselbe Medikament erhalten sollen, immer kleiner. "Dies zwingt die Unternehmen, in Forschung und Entwicklung billiger zu werden."
Zusätzlich leiden könnte der Medikamenten-Absatz zudem unter dem verstärkten Vormarsch von Prävention und Rehabilitation. Dass Pharmaindustrie und Chirurgen unter wachsendem Einfluss der Präventionsmediziner brotlos werden könnten, glaubt eine Ärztin indes nicht: "Die Infarkte treten einfach später auf."
| Private Schweizer Herzkliniken: Hirslanden führend pkn. Die überwiegende Zahl der Herzuntersuchungen und Herzoperationen werden in der Schweiz in universitären und nicht-universitären öffentlichen Kliniken durchgeführt. Aber auch drei Privatspitäler bieten - von Transplantationen abgesehen - die wichtigsten Herzoperationen an. Die grösste private Herzklinik des Landes ist jene der Hirslanden-Gruppe. Nach Auskunft von Sprecher Urs Brogli war die Zürcher Klinik "Anfang der dreissiger Jahre von ein paar Ärzten gegründet" worden. In einem "markanten Schritt" nahm Hirslanden 1986 den Betrieb des Herzzentrums auf. Als die Klinik Hirslanden 1990 die vier Privatspitäler der American Medical International (AMI) in Aarau ("Klinik im Schachen"), Bern ("Klinik Beau-Site"), Lausanne ("Clinique Cecil") und Zürich ("Klinik im Park") übernahm, weitete die mittlerweile zur "Hirslanden-Gruppe" gewachsene Klinik-Kette die Herz-Tätigkeiten auf fünf Standorte aus. Gesamthaft betreibt Hirslanden landesweit acht Akut-Kliniken. Laut Brogli wurden in den Hirslanden-Kliniken im Jahr 2000 rund 1660 herzchirurgische Eingriffe, über 7'300 Herzkatheteruntersuchungen und 1'780 Dilatationen durchgeführt. Somit werde, verrät die Website, "jede vierte Herzoperation in der Schweiz in einer der Hirslanden-Kliniken durchgeführt". Welchen Anteil die Herzuntersuchungen und -eingriffe am gesamten Umsatzvolumen ausmachen, konnte Brogli ebenso wenig verraten wie Umsatz und Wachstum der weitgehend zur UBS gehörenden Holding. Die Hirslanden-Gruppe, die zahlreiche weitere medizinische Fachgebiete anbietet, arbeitet mit über 1'000 auf eigene Rechnung tätigen Belegärzten zusammen. Dazu kommen 2'000 von der Hirslanden-Gruppe betriebene Vollstellen in den Gebieten Pflege, medizinische Fachbereiche, Ökonomie, Transport und Hausdienst. Seit Ende 1992 in Betrieb ist das private "Herz- und Neurozentrum Bodensee" in Kreuzlingen. Laut Verwaltungsleiter Christian Weisskopf beschäftigt die Klinik 140 Mitarbeiter, davon 20 Ärzte. Jahrestätigkeit: 1'000 Katheteruntersuchungen, 400 Dilatationen, 160 Herzoperationen. Als private Anbieterin im Tessin tritt das "Cardiocentro Ticino" in Lugano auf. |
| Diovan: Eine Erfolgs-Story von Novartis pkn. Der Blutdrucksenker Diovan, eine neue Klasse der sogenannten Angiotensin-Blocker, zählt zu den profitabelsten Pillen im Portfolio von Novartis. "Dieses Präparat ist einer unserer wichtigsten Wachstumsträger", freut sich Firmensprecher Mark Hill. 1996 kam es auf den Markt, vergangenes Jahr brachte es schon über eine Milliarde Franken Umsatz. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres verzeichnete es Verkäufe in Höhe von 800 Millionen Franken. In den USA zählt es zu den zehn am schnellsten wachsenden Blutdrucksenkern. "Es war von A bis Z ein Rennen gegen die Zeit", erinnert sich der Diovan-Erfinder Peter Bühlmayer, 50, an den Beginn des Forschungsprojektes im Jahr 1986 und die erste Synthese von Diovan in den Ciba-Geigy-Labors drei Jahre später. Auch DuPont war hinter einem ähnlichen Produkt her. Schliesslich war Diovan auch mit starkem Marketingaufwand unter die Ärzte gebracht worden. Chemiker Bühlmayer weiss noch, wie ihn und das Team das Erfolgserlebnis beflügelte: "Die chemische Struktur gab mir schnell ein gutes Gefühl insbesondere bezüglich Wirksamkeit und technischer Machbarkeit." Verträglichkeit und Sicherheit zeichnen heute das moderne Produkt aus. Peter Bühlmayer durfte letztes Jahr durch die American Chemical Society die Auszeichnung "Hero of chemistry" entgegennehmen - und einen Händedruck von Staatssekretär Colin Powell. Zu den weiteren umsatzstarken Herzmedikamenten von Novartis zählen der Blutdrucksenker Cibacen/Lotensin (Halbjahresumsatz 2001: 700 Millionen Franken) sowie der Cholesterinsenker Lescol (Halbjahresumsatz: 345 Millionen Franken). |
14. Oktober 2001